Auch nach über 650 Jahren lässt die klare Gliederung Baiershofens in zwei Häuserzeilen links und rechts des Angers die einst planmäßige Anlage des Dorfes erkennen. Diese Anlage aus einem Guss weist auf einen Grundherren hin, der hier freie Hand hatte, da die genannte Flur - damals ein Waldgebiet - ihm allein gehörte. Dies war das Kloster Fultenbach.
Wie sich aus dem "Dorfbrief" erschließen lässt, wurde das Land an eine Rodungsgenossenschaft vergeben, die den Wald rohden und das Land kultivieren sollte. Dazu holte das Kloster Siedler auf seine Waldflächen auf der Hochebene westlich der Zusam. Da in der Urkunde auch von "wismahd, das von alter dazu gehert" die Rede ist, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Neuanlage um die Verlegung der schon bisher bestehenden kleinen Siedlung um die frühere Andreaskirche herum, die südöstlich des heutigen Dorfes bestand. Zu den bisherigen Einwohnern mögen neue Siedler hinzugekommen sein. Die Siedler sollten durch landwirtschaftliche Tätigkeit nicht nur selbst ein Auskommen finden, sondern durch Pachtzahlungen und andere Abgaben die Einkünfte des Klosters erhöhen.
Hofstellen in Erbpacht
So wurden 21 Lehen angelegt, die den Siedlern und ihren Erben überlassen wurden. Die Lehen konnten (an vertrauenswürdige Leute) verkauft werden, d.h. der Käufer trat in die erpachtähnlichen Nutzungsrechte ein. Abgaben waren nicht nur für die jährlich zu leistende Pacht fällig, sondern auch beim Erbfall oder bei Veräußerung des Lehens. Darüber hinaus war der Zehnte für die Kirche und seelsorgerische Betreuung zu leisten sowie Frondienste (z.B. Fuhrdienste für das Kloster). Als Grundherr übte das Kloster außerdem die niedere Gerichtsbarkeit aus, überlies diese jedoch in weiten Teilen dem "Meister" (eine Art Bürgermeister, der außerdem die Pachtzahlungen einzutreiben hatte und dafür selbst abgabenfrei blieb). Lediglich über "Diebstahl, Notzucht und fließende Wunden" wollte das Kloster mit dem Vogt (ein weltlicher Vertreter für geistliche Herrschaften) selbst richten. Die höhere Gerichtsbarkeit oblag der Markgrafschaft Burgau (damals in Händen der österreichischen Habsburger).
Es stand den Baiershofern frei, eine Schmiede einzurichten und einen Hirten zu beschäftigen. Das Kloster hielt zudem einen Zuchtstier, einen Eber, einen Widder und einen Gänserich zur allgemeinen Nutzung für die Tierzucht des Dorfes. Jeder Lehensinhaber war zudem berechtigt, das Gemeineigentum zu nutzen, d.h. es gab Waldrechte und Weiderechte an sozusagen öffentlichen Flächen. Die Gemeindeweide am oberen und unteren Ende des Dorfes bestand bis Anfang des 19. Jahrhunderts; die Waldrechte der einzelnen Baiershofener Anwesen am ursprünglichen Gemeindewald bestehen heute noch.
Ursprünglich dürften die Rodungsflächen nördlich und südlich des Dorfes (im Anschluss an die Hofstellen) gelegen haben. D.h. es gab 2 Felder in denen jedes Anwesen seinen Anteil und bei bestehendem Flurzwang im Rahmen der Dreifelderwirtschaft bestellte.Später wurde im Nordosten des Dorfes ein weiteres Gewann (ein drittes Feld, genannt das "untere Feld") urbar gemacht, an dem die einzelnen Anwesen ihren Anteil bekamen (Quelle: Gerhard Ongyerth 1999)
Das Kloster sichert gesunde Dorfstruktur
Die ursprünglich gleichmäßige Orts- und Feldstruktur, bei der jeweils hinter einer Hofstelle die zugehörigen Feldstreifen begannen, wandelte sich bis in 16. Jahrhundert beträchtlich: Lehen wurden geteilt und geviertelt, Sölden (zusätzliche kleine Häuser ohne viel Grund, meist von Handwerkern und Taglöhnern) kamen hinzu und die Zahl der Häuser (Feuerstätten) hatte sich verdreifacht. Die Tandenz zur Besitzzersplitterung mit immer kleineren und damit unwirtschaftlichen Anwesen und zu Untertanen an der Armutsgrenze wollte das Kloster allerdings verhindern.
In diesem Zusammenhand entstand 1556 ein neues sehr wichtigen Dokument. Im Dorf herrschten offenbar Missstände: die Lehen waren immer weiter geteilt und die Häuser standen so dicht beieinander, dass ein Feuer große Teile des Dorf vernichten konnte. Mit den Sölden war eine unterbäuerliche soziale Schicht ins Dorf gekommen, die stets von Armut bedroht war. Im Gemeindewald wurde Raubbau getrieben. Statt die eigenen und die Schweine des Klosters mit dem "Geäcker" (Eicheln, Bucheckern - die Schweinemast fand teilweise im Wald statt) zu mästen, wurden offenbar Weiderechte an Ortsfremde verkauft und das eingenommene Geld dann verprasst. Gemeindeversammlungen wurden ohne Wissen des Klosters abgehalten.
Hier griff das Kloster nun ein und bestimmte, dass keine Lehen mehr geteilt und keine neuen Sölden gebildet werden dürften. Den bereits ansässigen Söldnern sollten ebenfalls (wenn auch geringere) Rechte am Gemeindewald zustehen. Die Holzentnahme im Gemeindewald soll sparsamer erfolgen (...damit nit die vätter reich und die sun arm werden). Bei außerordentlichem Holzbedarf sollte nur in Absprache mit dem Kloster vorgegangen werden. Die Niederschrift vom 20. Oktober 1556 bildet einen weiteren Vertragsbrief (Hauptstaatsarchiv München, Kloster Fultenbach, Lit.1, fol 123-126).
Ein erhaltene Akte des Klosters Fultenbach ist die Pfahlung-Renovation von 1782: Eine 63-seitige Urkunde, in der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baiershofen die Lage von Grunstücksgrenzen und gesamten Ortsflur aufgenommen ist.
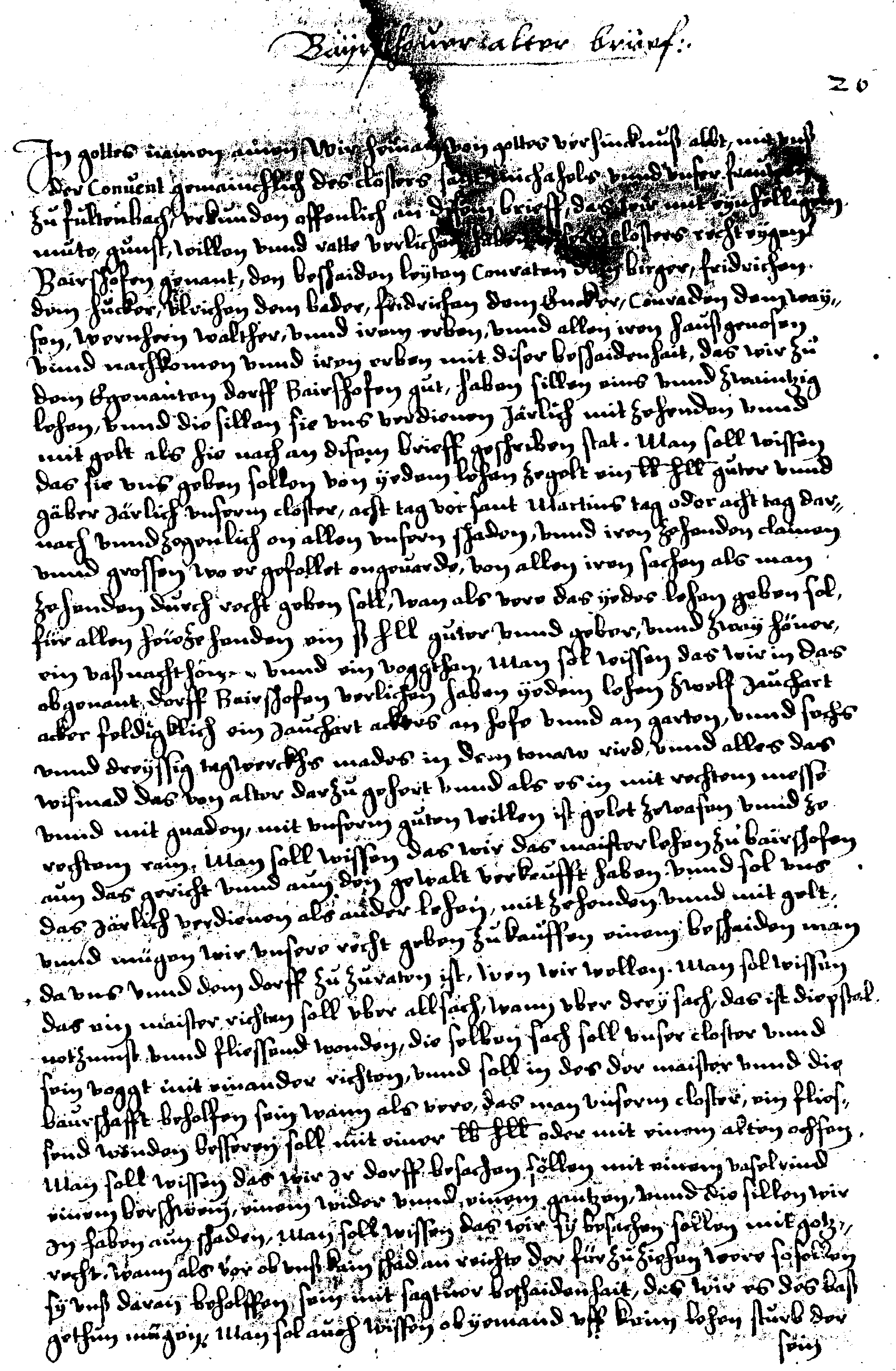
(zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)
Die "Gründungsurkunde" von Baiershofen ist der sog. Dorfbrief ("Bayrshouvr alter Brüaf") von 1350. Das Orginal gibt es jedoch nicht mehr. Was im Hauptstaatsarchiv im München bzw. im Staatsarchiv Augsburg aufbewahrt wird (Kloster Fultenbach, Lit.1, fol. 35-36), ist eine im 16. Jahrhundert entstandene Kopie einer Abschrift aus dem Jahr 1444.
Einer 1919 erstellten Expertise zufolge, ist die Urkunde jedoch keine Fälschung, sondern dürfte dem Original inhaltlich voll entsprechen (A. Schröder, Jahrbuch Hist. Verein Dillingen, Bd.32, 1919, S.24ff.).
Der Dorfbrief von 1350 im Wortlaut mit Erläuterungen
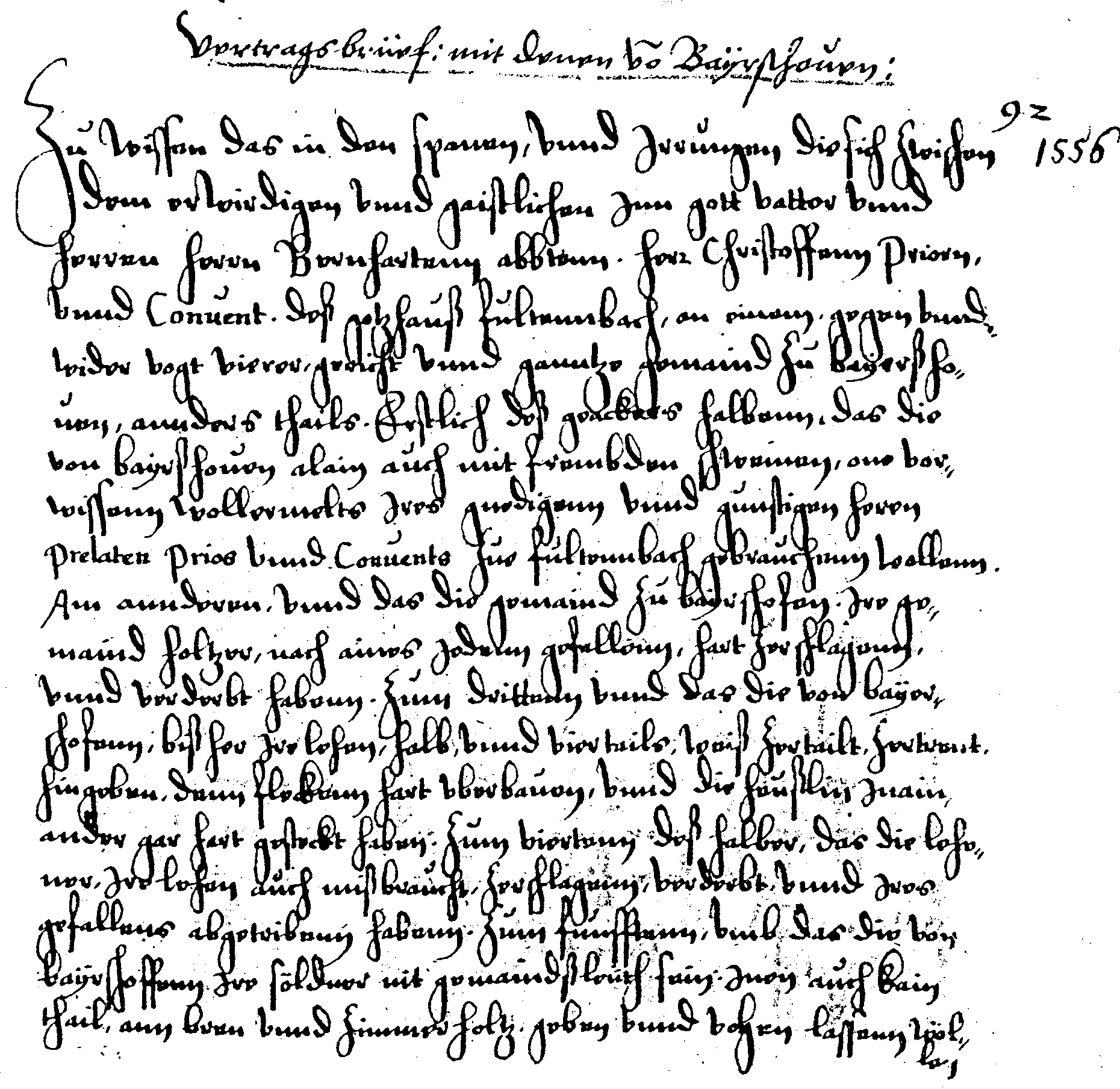
(zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken)
Vertragsbrüaf mit denen von Bayrshouvn Der Beginn des Vertragsbriefes von 1556, der angesichts von Missständen die Rechte der Dorfbewohner neu definierte